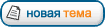Tribute–CDs gibt es heute wie Sand am Meer und die meisten sind eher gut gemeint als wirklich überzeugend. 1980 war das anders, wenn auch damals bereits diverse Bluesmusiker mit höchst unterschiedlichen Resultaten versucht hatten, Robert Johnson als den König dieses vielleicht amerikanischsten aller Musikgenres zu würdigen. Was nur zu verständlich ist, denn sein kurzes Leben und die Legenden, die sich darum ranken, faszinieren seit einem halben Jahrhundert jede Generation, die den Blues aufgreift und weiterentwickelt. Seine schmale Hinterlassenschaft von nur 29 Kompositionen wird von den Adepten in allen Nuancen seziert, studiert und immer wieder neu interpretiert. Manchmal wirkt das so, als würden sie dagegen anspielen wollen, dass viele Details der Lebensgeschichte des geheimnisvollen Mannes (an den sogar drei Grabstätten erinnern) dem Halbdunkel der Mythologie entrissen werden.
Im Grunde wäre Skepsis angebracht, denn wer kennt das nicht? Da erscheint eine CD mit uraltem Material, das Jahre oder Jahrzehnte in einem Archiv schlummerte, und die an dem Projekt beteiligten Personen oder ihnen wohlgesonnene Meinungsmacher in den Medien behaupten nun keck, dass es sich bei dem Werk, das nun mit immenser Verspätung das Licht der Welt erblickt, um nicht weniger als einen bisher verkannten und daher unbekannten Meilenstein der Musikgeschichte handelt, gegen den sich zur Zeit seiner Entstehung praktisch die gesamte Menschheit verschworen hatte. Der unbedarfte, aber gutgläubige Konsument aber, der auf diesen Hype hereinfällt und das Teil erwirbt, kommt zu dem Urteil, dass es genau dort hätte bleiben sollen, wo es herkommt, nämlich im Archiv. Jeder Sammler könnte wohl seine private Liste solcher Fehlkäufe anfertigen.
Im Fall von Possessions Robert Johnson-Projekt „Incarnation“ ist die Vorgeschichte ähnlich, aber doch auch ganz anders und sie beginnt Ende der 70er Jahre. Die Musikwelt erholte sich gerade von Disco und New Wave, Rap erhob wenig schüchtern sein hässliches Haupt und der Blues war außerhalb von elitären Expertenzirkeln, wie zwischenzeitlich immer mal wieder, megaout. Wer auch nur ein kleinwenig in musikhistorischen Bezügen dachte, hörte und kaufte, war gut beraten, sich mit der Gewissheit vertraut zu machen, dass die gerade angebrochene Dekade popkulturell eine Art Vorhölle werden würde. All dies hielt den Autor Clark Dimond aber nicht davon ab, ein Bühnenstück über das bewegte und bekanntlich mythengetränkte Leben des Blueskönigs Robert Johnson zu schreiben. Robert Johnson war damals alles andere als ein household name, dessen Erwähnung die Theaterwelt in Jubelstürme versetzte und so die Finanzierung des Projekts sicherte. Wenige tausend Bluesfreaks verehrten Robert Johnson natürlich, sonst kannte ihn kaum jemand. Johnsons seinerzeit von John Hammond Sr. kompilierte LP „The King of the Delta Blues Singers“, die jeden, wirklich jeden Musiker, der am Bluesrevival der Sixties beteiligt war, nachhaltig prägte, war gut abgehangene Geschichte ohne aktuellen Bezug. Der Mann selbst seit rund 40 Jahren unter der Erde. Und bis zur Veröffentlichung der Doppel–CD (3 LP – Box) „The Complete Recordings“ auf Columbia/Legacy, die ein sensationeller Verkaufserfolg werden und Robert Johnsons Bekanntheit enorm steigern sollte, war es noch ein Jahrzehnt hin.
Dimonds Timing war also alles andere als glücklich. Um mit seinem Vorhaben voranzukommen, brauchte er Kontakte in der Musikbranche, weshalb er von Colorado nach New York zog und dort Hammond Sr. kontaktierte, dem natürlich jedes Projekt, das Johnson späte Anerkennung verschaffen sollte, eine Herzensangelegenheit war. Er wies aber Dimond bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass es juristische Probleme geben könnte, wenn man Johnsons Vita auf die Bühne bringt. Da dieser aus, vorsichtig formuliert, unübersichtlichen Familienverhältnissen stammte, war mehr als klar, wer alles auftauchen und Rechte geltend machen könnte. Hammonds Befürchtungen waren nur zu begründet, denn Columbia sollte ein Jahrzehnt später in einen zähen und letztlich sehr kostspieligen Prozess verwickelt werden, bei dem es unter anderem um die Verwendung der beiden einzigen Fotos, die von Robert Johnson existieren, für die geplante Werkschau ging. Dimond und Gene Heimlich, ein weiteres musikhistorisches „Trüffelschwein“, das inzwischen als Mitstreiter gewonnen werden konnte, war sonnenklar, dass ihnen die Möglichkeiten eines Majors wie Columbia nicht zur Verfügung standen. Sie konzentrierten sich stattdessen erst einmal darauf, die für das Bühnenstück unverzichtbaren Neuinterpretationen von Johnsons Songs einzuspielen.
Die sechs Männer, die sich dann im Winter 1980/81 unter dem Namen Possession zusammenfanden und in den Wochen, die zwischen der Ermordung John Lennons und John W. Hinckleys gescheitertem Attentat auf Präsident Ronald Reagan lagen, 15 Kompositionen von Robert Johnson, des mythenumranktesten, vollkommensten und mit Sicherheit einflussreichsten aller Bluesmusiker einspielten, waren nicht unbedingt Puristen des Genres. Zwei von ihnen, Bassist Jerry Jemmott und Drummer Herb Lovelle, der von den Monkees bis zu Bob Dylan mit so ziemlich allen und jedem aufgenommen hatte, kamen vom Jazz und zählten zu den ausgefuchstesten Studiocracks New Yorks. „Groovemaster“ Jemmott, der später mit dem wilden Stilmix seiner Fusiontruppe Souler Energy für Furore sorgen sollte, hatte schon in den Roaring Twenties mit Fats Waller gespielt und gehörte in den Fünfzigern zu den Architekten des Atlantic–Soundes. Keyboarder T. C. James hatte kurz zuvor mit seinem Fist–O–Funk Orchestra avantgardistische Discosounds produziert, die in manchen Zirkeln noch heute Kultstatus genießen. Gitarrist Pat Conte, der die meisten akustischen Parts spielt, ist einer jener musicologists, der sich schon damals tief in die Geschichte der populären amerikanischen Musikformen eingegraben hatte. Conte zählt zu jenen sammelwütigen Wahnsinnigen, die ihre eigene musikalische Karriere zugunsten einer anderen Lebensaufgabe geopfert haben, in seinem Fall der, zehntausende Schellackplatten aus aller Welt zusammenzutragen und sie auf Long Island, wo er lebt, neben anderen Dingen mit und ohne Musikbezug in seinem Secret Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Arlen Roth, der ebenfalls Gitarre spielt (überwiegend elektrische) trägt aus heutiger Sicht den bekanntesten Namen aller Beteiligten. Damals stand er noch am Anfang seiner Karriere. Inzwischen ist er als Bandleader, Sideman, Studiomusiker, Produzent, Gitarrendesigner und Herausgeber von Lehrmaterial für angehende und fortgeschrittene Gitarristen in so vielen Funktionen parallel aktiv, dass man gar nicht recht weiß, auf welchem Feld seine Bedeutung am größten ist. Wenn man die CD hört, ohne zu wissen, dass sie ursprünglich für ein Theaterstück konzipiert wurde, ist wohl am erstaunlichsten, dass der unorthodoxe, jedoch vorzügliche Gesang von einem Mann namens Tucker Smallwood kommt, der eigentlich Schauspieler ist („The Cotton Club“, „The Rock“ oder „Deep Impact“) und als Musiker oder Sänger ansonsten kaum in Erscheinung getreten ist. Smallwood versucht erst gar nicht so zu klingen wie ein Schwarzer aus dem ländlichen Süden der dreißiger Jahre. Dennoch ist seine Stimme ausdrucksstark, erstaunlich wandlungsfähig und wohl schon allein deshalb bluestauglich, weil ihr Besitzer bei einem Fronteinsatz im Vietnamkrieg unter friendly fire geriet und von einem Granatsplitter im Hals getroffen wurde. Zunächst für tot erklärt, wurde Smallwood per Helikopter in ein Feldlazarett evakuiert, wo ihn viel Morphium und die Songs von Robert Johnson, mit denen ihn eine Krankenschwester (!) bekannt machte, ins Reich der Lebenden zurückholten. Wenn’s stimmt und nicht nur eine jener durchaus üblichen Schmonzetten ist, mit denen im amerikanischen Filmbusiness durchgeknallte PR–Agenten die Biographien ihrer Klienten schmücken, eine durchaus beeindruckende Vita.
Tucker Smallwood und seine musikalischen Mitstreiter taten jedoch mehr, als sich einfach fünfzehn Perlen aus Johnsons Oevre herauszupicken und neu zu interpretieren, wobei erwähnenswert ist, dass mit „Mean Black Spider“ und „Little Boy Blue“ zwei Songs enthalten sind, die Johnson selbst gar nicht aufgenommen hat. Sie setzten auf eine dieser „Was wäre gewesen, wenn... – Situationen“, die dem rückgewandten Umgang mit Kulturgeschichte oft überraschende und höchst innovative Aspekte anbietet. Dimond, Heimlich & Co. gingen von einer klar umrissenen Prämisse aus, die da hieß: Wie hätte sich Robert Johnsons Musik möglicherweise in einem urbanen Milieu verändert, wenn er es, wie es geplant gewesen war, 1938 nach New York gekommen wäre und dort den Durchbruch zur landesweit populären Größe geschafft hätte? Bekanntlich verhinderte ja der tödliche Giftanschlag eines eifersüchtigen Ehemanns, dass Robert Johnson im Rahmen der von John Hammond Sr. organisierten Bühnenshow „Spirituals to Swing“ in der Carnegie Hall dem liberalen weißen Publikum New Yorks präsentiert wurde, wodurch ihm wohl Karrieremöglichkeiten offengestanden hätten, von denen Bluesmusiker, die nur im Süden aktiv waren, nicht einmal zu träumen gewagt hätten.
Diese Ausgangsidee und der Ansatz, einige von Johnsons Meilensteinen (u.a. Robert Plants Lieblingsstück „Walking Blues“, Robert Johnsons zu Lebzeiten bestverkaufteste Nummer „Terraplane Blues“ oder das von den Rolling Stones berühmt gemachte „Love in Vain“) in einem Bandkontext zu interpretieren, führten dazu, dass all diese x–mal und vielleicht sogar zu oft gehörten Songs so klingen, wie sie Robert Johnson eventuell 1980 (da wäre er 69 gewesen) unterstützt von einer knackigen Combo und eben mit den technologischen Möglichkeiten der Gegenwart zum Besten gegeben hätte.
Als die Aufnahmen schließlich im Kasten waren, schienen sich der Schwerpunkt des Projekts verschoben und der Plan, Johnsons kurze Lebensgeschichte auf die Bühne zu bringen, verflüchtigt zu haben. Die Musiker liefen auseinander, um sich neuen Aufgaben zu widmen, Dimond und Heimlich blieben mit den Aufnahmen zurück und nahmen die Postproduction in Angriff. Nachdem diese abgeschlossen war, stellte sich aber bald heraus, dass die beiden nicht über die richtigen Branchen-Kenntnisse verfügten, um „Incarnation“ bei einem geeigneten Label unterzubringen.
Enttäuscht vom Verlauf des Unternehmens, zog sich Dimond nach Colorado zurück, wo er für den Rundfunk arbeitete, sich ein kleines Studio baute und neue Stücke schrieb. Da auch die an den Aufnahmen beteiligten Musiker nichts für eine späte Veröffentlichung taten, gerieten die Bänder in Vergessenheit. Je mehr Zeit verging, desto heftiger wurde jedoch Clark Dimond von Gewissensbissen geplagt, solch gute Musik einfach im Regal verstauben zu lassen. Als dann Columbia für die Johnson–Box sogar einen Grammy eingeheimst hatte, war die generelle Aufnahmebereitschaft für alles, was mit Robert Johnson zu tun hatte, zwar ungleich größer als noch 1981, doch jetzt zeigten die für eine Veröffentlichung in Frage kommenden Labels Berührungsängste, weil sie Ärger bezüglich der Tantiemenverteilung befürchteten – mit dem traurigen Resultat, dass immer noch kein Deal zustande kam. Dimond ließ jodch nicht locker und fertigte im Lauf der neunziger Jahre einen neuen digitalen Mix der Aufnahmen an, von dem er dann auf eigene Rechnung eine CD-Kleinstserie ohne gedrucktes Beiwerk und graphische Gestaltung fertigen ließ, die von Arlen Roth und Tucker Smallwood übers Internet vertrieben wurden.
Erwartungsgemäß fand Dimonds Privatedition von „Incarnation“ unter den ausgemachten Bluesenthusiasten große Beachtung. Was lag also näher als der Gedanke, diesen Aufwind zu nutzen und das Werk jetzt endlich offiziell zu veröffentlichen. Und so kann in dieser Hinsicht nach nunmehr 27 Jahren (dem Alter übrigens, in dem Robert Johnson starb) Vollzug gemeldet werden.